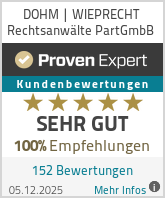Was Sie über Wettbewerbsverbote nach der Kündigung wissen sollten.

Als erfahrene Fachanwälte für Arbeitsrecht beraten und unterstützen wir Sie bei allen Fragen zum Thema Wettbewerbsverbot nach Kündigung. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter 040 468 99 70 90 oder per E-Mail an: info@dw-arbeitsrecht.de
Nach einer Kündigung stellt sich für viele Arbeitnehmer die Frage: Darf ich jetzt bei der Konkurrenz arbeiten?
Gleichzeitig fragen sich Arbeitgeber, wie sie verhindern können, dass ehemalige Mitarbeiter ihr Wissen oder ihre Kontakte bei einem Wettbewerber einsetzen.
Das sogenannte nachvertragliche Wettbewerbsverbot soll genau hier ansetzen – doch nicht jede Klausel ist wirksam und oft ergeben sich finanzielle oder rechtliche Folgen für beide Seiten.
In diesem Beitrag erfahren Sie, wann ein Wettbewerbsverbot gültig ist, welche Rechte und Pflichten sich daraus ergeben und wie Sie sich als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer richtig verhalten können.
Das Wichtigste im Überblick
- Warum Wettbewerbsverbote so wichtig sind
- Was genau ist ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot?
- Voraussetzungen für ein wirksames Wettbewerbsverbot
- Karenzentschädigung – Pflicht und Berechnungsgrundlage
- Wettbewerbsverbot im Aufhebungsvertrag
- Verzicht oder Befreiung vom Wettbewerbsverbot
- Typische Fehler in der Praxis
- Wann rechtliche Beratung sinnvoll ist
- Fazit – das Wichtigste auf einen Blick
- Häufige Fragen (FAQ)
Warum Wettbewerbsverbote so wichtig sind
Ein Wettbewerbsverbot soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer schaffen. Arbeitgeber möchten ihr Know-how, vertrauliche Informationen oder Kundenkontakte schützen. Arbeitnehmer hingegen wollen nach einer Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag nicht in ihrer beruflichen Freiheit eingeschränkt werden.
Gerade in Positionen mit Kundenkontakt, Einblicken in vertrauliche Daten oder strategischem Wissen kann ein Wechsel zur Konkurrenz zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen.
Ein rechtssicher formuliertes Wettbewerbsverbot kann hier Klarheit schaffen – aber nur, wenn es fair und ausgewogen gestaltet ist.
Was genau ist ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot?
Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot gilt – anders als das Wettbewerbsverbot während des bestehenden Arbeitsverhältnisses – erst nach dessen Beendigung.
Es verpflichtet den ausgeschiedenen Mitarbeiter, für einen bestimmten Zeitraum nicht in Konkurrenz zum früheren Arbeitgeber zu treten. Das kann sowohl eine Anstellung bei einem Wettbewerber als auch eine eigene selbständige Tätigkeit in derselben Branche betreffen.
Solche Vereinbarungen sind nur dann gültig, wenn sie schriftlich getroffen und von beiden Seiten unterschrieben wurden. Sie können direkt im Arbeitsvertrag oder separat – etwa im Aufhebungsvertrag – festgehalten werden.
Beispiel aus der Praxis:
Ein Key Account Manager verlässt ein Unternehmen und möchte kurz darauf bei einem direkten Mitbewerber anfangen. Im Arbeitsvertrag findet sich jedoch eine Klausel, die ihm dies für 12 Monate untersagt – gegen Zahlung einer Entschädigung. Ob die Klausel wirksam ist, hängt davon ab, ob sie rechtlich korrekt formuliert wurde und die Entschädigung angemessen ist.
Voraussetzungen für ein wirksames Wettbewerbsverbot
Damit ein Wettbewerbsverbot nach einer Kündigung wirksam ist, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:
- Schriftform: Das Wettbewerbsverbot muss schriftlich vereinbart und von beiden Seiten unterschrieben werden. Mündliche Absprachen sind unwirksam.
- Höchstdauer von zwei Jahren: Das Verbot darf höchstens zwei Jahre ab Ende des Arbeitsverhältnisses gelten. Längere Zeiträume sind nicht zulässig.
- Karenzentschädigung: Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer für die Dauer des Verbots mindestens 50 % der zuletzt bezogenen vertraglichen Gesamtvergütung zahlen. Dazu zählen auch variable Bestandteile wie Provisionen oder Boni.
- Berechtigtes Interesse des Arbeitgebers: Das Verbot darf nur Bereiche betreffen, in denen der Arbeitgeber tatsächlich ein schützenswertes Interesse hat. Zu weit gefasste Klauseln – etwa pauschale Branchenverbote – sind meist unwirksam.
- Keine unzumutbare Einschränkung: Das Wettbewerbsverbot darf den Arbeitnehmer nicht übermäßig in seiner beruflichen Entwicklung behindern.
Wenn eine dieser Voraussetzungen fehlt, kann das gesamte Wettbewerbsverbot nichtig sein.
Karenzentschädigung – Pflicht und Berechnungsgrundlage
Die Karenzentschädigung ist keine freiwillige Leistung, sondern gesetzlich vorgeschrieben (§ 74 HGB).
Sie soll sicherstellen, dass der Arbeitnehmer während des Verbotszeitraums finanziell abgesichert bleibt.
Die Höhe beträgt mindestens 50 % der letzten Gesamtvergütung – also einschließlich Fixgehalt, Boni, Prämien und ggf. Sachleistungen. Zahlt der Arbeitgeber diese Entschädigung nicht, kann der Arbeitnehmer das Wettbewerbsverbot ignorieren und trotzdem eine Stelle bei der Konkurrenz annehmen.
Für Arbeitgeber bedeutet das: Nur wenn die Entschädigung korrekt geregelt ist, lässt sich das Wettbewerbsverbot auch tatsächlich durchsetzen.
Für Arbeitnehmer heißt das: Wer eine Wettbewerbsverbotsklausel unterzeichnet hat, sollte prüfen, ob die Entschädigung klar und fair vereinbart wurde.
Wettbewerbsverbot im Aufhebungsvertrag
Besonders häufig finden sich Wettbewerbsverbote in Aufhebungsverträgen.
Das ist grundsätzlich zulässig, doch auch hier gelten dieselben Voraussetzungen wie beim Arbeitsvertrag.
Gerade Arbeitnehmer übersehen dabei oft, dass sie sich damit für Monate oder Jahre binden – manchmal ohne ausreichende Entschädigung.
Ein Beispiel:
Eine Arbeitnehmerin erhält ein attraktives Angebot zur einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Der Aufhebungsvertrag enthält jedoch ein Wettbewerbsverbot ohne Entschädigung. In diesem Fall ist die Klausel unwirksam, und die Arbeitnehmerin darf sofort zu einem Konkurrenten wechseln.
Arbeitgeber sollten daher auf eine rechtssichere Formulierung achten, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Sie haben einen Aufhebungsvertrag erhalten? Dies müssen Sie beachten.
Verzicht oder Befreiung vom Wettbewerbsverbot
Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer können sich in bestimmten Fällen vom Wettbewerbsverbot lösen.
Arbeitgeber können schriftlich auf das Wettbewerbsverbot verzichten.
Die Folge: Der Arbeitnehmer ist ab sofort frei – der Arbeitgeber muss aber noch ein Jahr lang die vereinbarte Karenzentschädigung zahlen (§ 75a HGB). Ein voreiliger Verzicht kann also teuer werden.
Arbeitnehmer können das Wettbewerbsverbot ignorieren, wenn es unwirksam ist – etwa wegen fehlender Entschädigung oder zu weit gefasster Regelungen. Eine anwaltliche Prüfung schafft hier Klarheit.
Sichern Sie Ihre Rechte bei Wettbewerbsverboten
Ein rechtssicher gestaltetes Wettbewerbsverbot schützt Ihre wirtschaftlichen Interessen – egal, ob Sie als Arbeitgeber sensible Unternehmensdaten absichern möchten oder als Arbeitnehmer prüfen wollen, welche Verpflichtungen nach einer Kündigung tatsächlich bestehen. Wir bei DOHM | WIEPRECHT beraten Sie individuell und kompetent, prüfen bestehende Wettbewerbsverbote und entwerfen auf Wunsch rechtssichere Klauseln, die Ihre Position stärken.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin – telefonisch, per Videocall oder direkt in unserer Kanzlei in Hamburg. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihr Wettbewerbsverbot klar, wirksam und fair geregelt ist.
Typische Probleme in der Praxis:
In der Beratungspraxis treten bei Wettbewerbsverboten häufig ähnliche Schwierigkeiten auf. Oft sind die Tätigkeitsverbote unklar oder zu weit gefasst, sodass nicht eindeutig erkennbar ist, welche Tätigkeiten tatsächlich eingeschränkt werden. Ein weiterer häufiger Punkt ist die Karenzentschädigung.
Sie fehlt manchmal ganz oder wird zu niedrig bemessen, sodass das Verbot rechtlich angreifbar ist. Auch der räumliche Geltungsbereich wird nicht immer klar definiert, was später zu Streitigkeiten führen kann. Zudem kommt es vor, dass ein Arbeitgeber auf ein bestehendes Wettbewerbsverbot nicht schriftlich verzichtet, obwohl dies rechtlich erforderlich wäre.
Besonders in Aufhebungsverträgen fehlen manchmal faire Gegenleistungen für das Wettbewerbsverbot, was die Wirksamkeit infrage stellt. Solche Unklarheiten führen nicht selten zu rechtlichen Auseinandersetzungen. Viele Konflikte lassen sich jedoch vermeiden, wenn die Vereinbarung frühzeitig geprüft und präzise formuliert wird.

Sie möchten Ihren Arbeitsvertrag prüfen lassen? Mehr dazu in diesem Beitrag
Wann rechtliche Beratung sinnvoll ist
Ein Wettbewerbsverbot wirft häufig rechtliche Fragen auf – insbesondere, wenn unklar ist, ob die Vereinbarung wirksam oder zu weit gefasst ist. Schon kleine Formulierungsfehler können darüber entscheiden, ob ein Verbot tatsächlich bindend ist oder nicht.
In der Praxis kommt es oft darauf an, ob die Interessen beider Seiten angemessen berücksichtigt wurden und die Karenzentschädigung korrekt berechnet ist. Gerade bei leitenden Angestellten oder Fachkräften mit sensiblen Informationen empfiehlt sich daher eine rechtliche Überprüfung.
Erfahrene Fachanwälte für Arbeitsrecht können einschätzen, ob eine Klausel wirksam ist, welche Rechte und Pflichten daraus entstehen und welche Schritte im Einzelfall sinnvoll sind – sei es bei der Vertragsgestaltung, bei laufenden Verhandlungen oder im Streitfall.
Fazit – das Wichtigste in Kürze
- Ein Wettbewerbsverbot nach Kündigung ist nur wirksam, wenn es schriftlich, zeitlich begrenzt und angemessen entlohnt ist.
- Arbeitgeber müssen eine Karenzentschädigung von mindestens 50 % zahlen.
- Das Verbot darf höchstens zwei Jahre dauern.
- Zu weit gefasste oder unfaire Klauseln sind unwirksam.
- Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer können sich unter bestimmten Voraussetzungen vom Verbot lösen.
- Eine anwaltliche Prüfung schützt vor teuren Fehlern und rechtlichen Auseinandersetzungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wenn keine Karenzentschädigung vereinbart wurde, die Dauer zu lang ist oder das Verbot den Arbeitnehmer unzumutbar einschränkt.
Mindestens 50 % der zuletzt bezogenen Gesamtvergütung, einschließlich variabler Bestandteile.
Maximal zwei Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Ja, durch schriftliche Erklärung. Die Zahlungspflicht bleibt aber noch für ein Jahr bestehen.
Ja, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und eine angemessene Entschädigung vereinbart wird.
Durch schriftlichen Verzicht des Arbeitgebers oder wenn die Klausel unwirksam ist.
Schriftform, Karenzentschädigung, angemessene Dauer, berechtigtes Interesse und keine übermäßige Einschränkung.
Bildquellennachweis: Farknot_Architect / Canva.com
Über die Autoren:
Sebastian T. Dohm & Jan-Benedikt Wieprecht
Sebastian T. Dohm und Jan-Benedikt Wieprecht sind als Fachanwälte für Arbeitsrecht in Hamburg tätig und beraten seit Jahren Arbeitnehmer, Führungskräfte und Unternehmen in allen Fragen des Arbeitsrechts.
Die auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei DOHM | WIEPRECHT Rechtsanwälte steht für fundierte, praxisnahe und rechtssichere Beratung – persönlich vor Ort in Hamburg oder bundesweit digital, wenn es insbesondere um Kündigung, Aufhebungsvertrag, Abfindung oder Vertragsgestaltung geht.

Sebastian T. Dohm
Rechtsanwalt Hamburg
Fachanwalt Für Arbeitsrecht Hamburg

Jan-Benedikt Wieprecht
Rechtsanwalt Hamburg
Fachanwalt Für Arbeitsrecht Hamburg